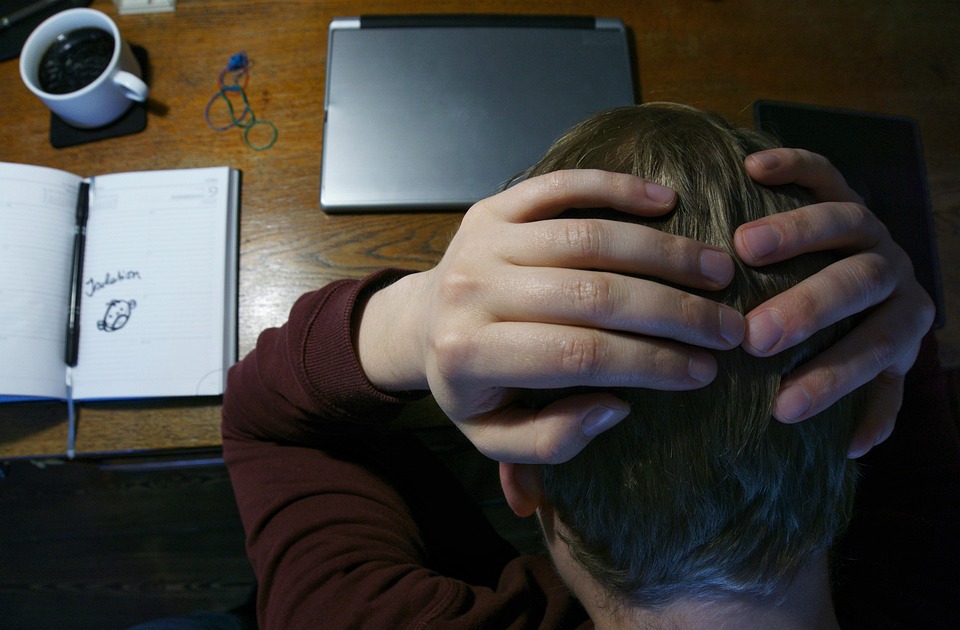
Die Corona-Hilfspakete der Bundesregierung- Wirtschaft first, Soziales second
So die Devise des Überbrückungsgelds für Studierende im Rahmen der Corona-Hilfe in Deutschland. Diese soll Menschen helfen, welche sich in einer „pandemiebedingten Notlage“ befinden. Sollte der Antrag auf Überbrückungshilfe genehmigt werden, wird das jeweilige Kontosaldo auf maximal 599,99 Euro aufgestockt. Als Maßstab dient also der Kontostand am Tag der Antragstellung. So kam es, dass Deborahs Antrag kurzerhand abgelehnt wurde. Sie ist 25 Jahre alt und studiert Bühnen- und Kostümbild in Berlin. Sie wohnt alleine, bezieht BAföG und hat nebenbei in der Gastronomie gearbeitet. Aus diesem Minijob-Verhältnis wurde sie, mit Beginn der zweiten Welle der Corona-Pandemie erneut entlassen. „Erneut“ deshalb, da sie auch schon während der ersten Welle im März 2020 entlassen wurde. In dieser Zeit sah sie sich dazu gezwungen, ihre Ersparnisse aufzubrauchen. Nun dachte sie, dass sie aufgrund ihrer Notsituation Anspruch auf finanzielle Hilfe hätte. Doch wurde ihr Antrag abgelehnt. Die Mietkosten waren noch nicht von ihrem Konto abgegangen und sie hatte noch knapp über 500 Euro auf ihrem Konto.
Damit ist Deborah kein Einzelfall. Insgesamt wurden 36 Prozent aller Anträge abgelehnt. Hauptgrund war, dass die finanzielle Not der Studierenden schon vor der Corona-Krise bestand. Aber auch, wenn nicht hervorging, dass die Kündigung des Nebenjobs mit der Pandemie in Zusammenhang steht, wurde der Antrag abgelehnt.
Wo bleibt die schnelle und unbürokratische Hilfe, die allen Betroffenen versprochen wurde? Anfang 2020 hatte die Bundesregierung Maßnahmen von 819 Milliarden Euro verabschiedet und vom "größten Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands" gesprochen. Doch wie den zehntausenden Studierenden geht es auch vielen anderen prekär Beschäftigten.
Im Laufe des Jahres verloren knapp eine Millionen Menschen ihren Minijob und über sieben Millionen gingen in Kurzarbeit. Die Ausweitung und Erhöhung des Kurzarbeitergeldes hat zwar viele Menschen vor einer abrupten Arbeitslosigkeit bewahren können, das Problem der drohenden Armut jedoch nur vertagt. Zudem lag die Arbeitslosenquote trotz dieser Maßnahmen Ende November 2020 bei 5,9% - im Jahr zuvor hatte sie noch bei 4,9% gelegen.
Schließlich warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem Armutsbericht, dass die Armutsquote in Deutschland mittlerweile das Niveau der 90er Jahre erreicht habe - 13 Millionen Menschen seien demnach davon betroffen. Diese Zahlen bilden jedoch kein aktuelles Bild ab, da sich die Situation im Zuge der zweiten Corona-Welle verschärft haben dürfte.
Unterdessen vergrößerten sich die Einkommens- und Vermögensunterschiede während der Corona-Krise weiter. Während ein Drittel der Bevölkerung weiterhin über keine nennenswerten Rücklagen verfügt, erhöhte sich das Vermögen der Milliardär:innen in wenigen Monaten um ca. 28% auf knapp 600 Milliarden Euro. Insbesondere Unternehmen der Technologie- sowie der Gesundheitsbranche profitierten von teilweise schwindelerregenden Preisen ihrer Aktien im Laufe der Pandemie. So verdreifachte sich beispielsweise der Wert der BioNTech-Aktien innerhalb eines Jahres, was frühen Investoren wie den Milliardärszwillingen Strüngmann, die mutmaßlich die Hälfte aller BioNTech-Aktien halten, riesige Zuwächse verschaffte.
Weiterhin wurden Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft eine Priorisierung zuteil. Allein die Lufthansa erhielt staatliche Hilfen im Umfang von neun Milliarden Euro. Zum Vergleich: die Hilfen für die soziale Sicherung Selbstständiger betrugen 7,5 Milliarden Euro. Die größte familienpolitische Maßnahme war der sogenannte Kinderbonus von 300 Euro pro Kind, dessen Gesamtsumme 4,3 Milliarden Euro betrug. Ein wichtiges Zeichen und willkommene Entlastung für zahlreiche Familien- als Einmalzahlung konzipiert, war er aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Obgleich die Finanzhilfen der Bundesregierung sicherlich einen Teil der Folgen der Pandemie kurzfristig abfedern konnten, gibt es Haushalte in Deutschland, die im Zuge der Corona-Krise finanziell schwer getroffen wurden und denen die Zuschüsse nur begrenzt bis gar nicht aushelfen konnten. Das betrifft insbesondere geringfügig Beschäftigte, Menschen mit niedrigem Einkommen sowie Selbstständige und Freiberufler:innen. Es ist der Bundesregierung trotz milliardenschweren Hilfsprogrammen nicht gelungen, prekär Beschäftigte und Menschen mit geringem Einkommen ausreichend vor den Folgen der Pandemie zu schützen.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch durch die Corona Pandemie weiter auf. Dass es auch anders geht, zeigt der Vorschlag von Prof. Dr. Butterwegge, die Reichen an den Kosten für die Hilfspakete zu beteiligen. So könnte vielen Menschen in einer akuten Notlage geholfen und die soziale Ungleichheit ein wenig gemindert werden.
Antonia Leymann und Hannes Richter








